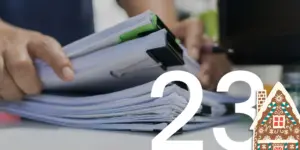Forschungszulage und Preisgelder
Was steuerlich zu beachten ist
Investitionen und Innovationen sind unabdingbar, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. Einer der strategisch wichtigen, innovativen Sektoren ist der Gesundheitsbereich. Mit der Gesundheitsforschung von heute werden die Weichen für die Gesundheitsversorgung und die Wettbewerbsfähigkeit der Gesundheitsindustrie von morgen gestellt.
Staatliche Förderung mit Forschungszulage
Um Grundlagenforschung, industrielle wie auch experimentelle Forschung zu fördern, wurde mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung eine Forschungszulage eingeführt. Damit wird ein Teil der Aufwendungen für Forschungsvorhaben direkt vom Staat erstattet. Die Forschungszulage können alle steuerpflichtigen Unternehmen – auch Unternehmen des Gesundheitswesens – beantragen, sofern sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Forschungsvorhaben können durchgeführt werden als eigenbetriebliche Forschung, als Auftragsforschung, als Kooperationsvorhaben oder als Kombination derselben. Ob und inwieweit ein begünstigtes Forschungsvorhaben vorliegt, entscheidet ausschließlich die Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ).
Förderfähige Aufwendungen
Förderfähig sind nur solche Aufwendungen, die unmittelbar auf begünstigte Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten in einem begünstigten Vorhaben entfallen. Dazu gehören beispielsweise die Lohnkosten inkl. Zukunftssicherungsleistungen der beteiligten Mitarbeiter bzw. auch die Eigenleistung des Unternehmers.
Als Eigenleistung können pauschal 40 Stunden pro Woche anerkannt werden, die mit maximal 70 Euro (100 Euro ab 1. Januar 2026) pro Stunde förderfähig sind. Für nach dem 27. März 2024 angeschaffte abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die für die Durchführung des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens erforderlich sind und ausschließlich eigenbetrieblich verwendet werden, gehören auch die Abschreibungen zu den zu den förderfähigen Aufwendungen.
Mit dem Gesetz für ein steuerliches Sofortprogramm werden die förderfähigen Aufwendungen für nach dem 31. Dezember 2025 begonnene Forschungsvorhaben ausgeweitet. Zusätzliche Gemein- und sonstige Betriebskosten können pauschal mit 20 % der förderfähigen Aufwendungen angesetzt werden.
Höhe der Forschungszulagen
Die Forschungszulage beträgt
- 25 % der förderfähigen Aufwendungen für alle begünstigten Vorhaben eines Wirtschaftsjahres.
Hinweis: Kleine- und mittelständische Unternehmen können für Forschungsvorhaben nach dem 26. März 2024 eine Zulage von 35 % erhalten.
Die maximale Bemessungsgrundlage beträgt
- 10 Mio. Euro für nach dem 27. März 2024 und
- 12 Mio. Euro für nach dem 31. Dezember 2025
entstandene förderfähige Aufwendungen.
Forschungszulagen und staatliche Beihilfen dürfen je Forschungsvorhaben und Unternehmen insgesamt 15 Mio. Euro nicht übersteigen.
Zweistufiges Antragsverfahren notwendig
Schritt 1: Bei der Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ) muss vor, während oder nach der Durchführung des Forschungsvorhabens eine Bescheinigung beantragt werden. Bei einem erfolgreichen Antrag erstellt das BSFZ eine Bescheinigung als Grundlagenbescheid und leitet diesen an das zuständige Finanzamt weiter.
Schritt 2: Die Forschungszulage muss beim Finanzamt elektronisch über das Elsterportal beantragt werden. Das ist erst nach Ablauf des Wirtschaftsjahres möglich, in dem die förderfähigen Aufwendungen für begünstigte Vorhaben entstanden sind. Der Antrag ist spätestens bis zum Ablauf der Festsetzungsfrist (grundsätzlich vier Jahre) des entsprechenden Wirtschaftsjahres zu stellen.
Steuerliche Behandlung der Forschungszulage
Das Finanzamt setzt die Forschungszulage fest und verrechnet diese mit der nächsten Steuer(Voraus)zahlung zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer. Ein verbleibendes Guthaben wird als Steuererstattung ausgezahlt. Im Ergebnis ist die Forschungszulage ein echter umsatzsteuerfreier Zuschuss des Staates. Und auch ertragsteuerlich gehen Gesetzgeber und Finanzverwaltung aktuell davon aus, dass die Forschungszulage steuerfrei ist.
Preisgeld als Belohnung für Forschungsergebnisse
Bei erfolgreichen Forschungsvorhaben wird die exzellente Arbeit von Forschern oft mit einem Preisgeld belohnt. Institutionen wie die Deutsche Herzstiftung, die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie und das Zentralinstitut der kassenärztlichen Versorgung vergeben solche Auszeichnungen, um wissenschaftliche Leistungen zu honorieren. Doch spätestens, wenn das Preisgeld auf dem Konto eingeht, stellt sich die Frage, ob es steuerlich relevant ist.
Ob Preisgelder der Besteuerung unterliegen, hängt von den spezifischen Ausschreibungsbedingungen, Zielen der Preisverleihung und zugrunde liegenden Leistungen ab. Preisgelder, die im Zusammenhang mit einer steuerpflichtigen Einkunftsart stehen, müssen versteuert werden. Hierbei kommen insbesondere Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, freiberufliche Einkünfte oder sonstige Einkünfte infrage. Einkünfte, die unter keine der Einkunftsarten des Einkommensteuergesetzes fallen, unterliegen nicht der Einkommensteuer.
Steuerpflichtige Preisgelder
Ein Preisgeld gilt als steuerbares Einkommen, wenn es wirtschaftlich den Charakter eines leistungsbezogenen Entgelts hat und eng an die berufliche Tätigkeit gekoppelt ist. Auch Preisgelder, die die berufliche Entwicklung des Preisträgers fördern sollen, sind steuerpflichtig. Dies betrifft unter anderem Geldpreise mit Zuschusscharakter, die vom Empfänger im Rahmen seiner ausgeübten beruf lichen Tätigkeit verwendet werden müssen.
So gelten Preisgelder als Arbeitslohn, wenn sie „für“ eine Beschäftigung im öffentlichen oder privaten Dienst gewährt werden. Dies gilt unabhängig davon, ob ein Rechtsanspruch auf die Vergütung besteht und ob es sich um laufende oder um einmalige Bezüge handelt. Das gilt auch für Preisgelder von Dritten, wenn sie in einem ausreichenden Zusammenhang mit der Tätigkeit für den Arbeitgeber stehen.
Nichtsteuerbare Preisgelder
Preise, deren Verleihung in erster Linie dazu bestimmt sind, das Lebenswerk des Empfängers zu würdigen, die Persönlichkeit des Preisträgers zu ehren, eine Grundhaltung auszuzeichnen oder eine Vorbildfunktion herauszustellen, haben hingegen keinen Zusammenhang mit einer Einkunftsart. Dies gilt selbst, wenn im Einzelfall eine konkrete Leistung der Anlass für die Preisverleihung war. Davon ist z. B. bei der Vergabe des Nobelpreises auszugehen.
Alle Einkunftsarten müssen geprüft werden
Im Einzelfall müssen alle Einkunftsarten geprüft werden. Das zeigt ein aktuelles Urteil des Bundesfinanzhofes (BFH). Der BFH verneinte die Steuerbarkeit eines Wissenschaftspreises für eine Habilitationsschrift, da der Steuerpflichtige diese zum ganz überwiegenden Teil vor der Berufung in sein aktuelles Professorendienstverhältnis verfasst hatte. Zwar lag der mit dem Preis ausgezeichneten Habilitation eine wissenschaftliche Forschungsleistung zugrunde. Das preisverleihende Institut hatte mit dem Wissenschaftspreis jedoch die zuvor erbrachte wissenschaftliche Tätigkeit des Steuerpflichtigen gewürdigt und ausgezeichnet.
- Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit: Der BFH fand keine Anhaltspunkte dafür, dass das Preisgeld für die vorherige nichtselbständige Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder nebenberuflich tätiger Lehrbeauftragter zugewandt wurde. Es sollte nach den Förderrichtlinien vielmehr der Wissenschaftsförderung dienen und wies damit keinen Bezug zur betrieblichen Tätigkeit des Steuerpflichtigen auf.
- Einkünfte aus selbständiger Arbeit: Eine Förderlichkeit der Habilitation für die freiberufliche Tätigkeit allein reicht für den wirtschaftlichen Berufsbezug des Preisgeldes zu Einkünften aus selbständiger Arbeit nicht aus.
- Sonstige Einkünfte: Der BFH ordnete das Wissenschaftspreisgeld auch nicht den sonstigen Einkünften zu, da die Arbeiten nicht mit der Absicht verfasst wurden, einen Preis zu gewinnen. Zwar kann zu sonstigen Einkünften grundsätzlich jedes Tun, Dulden oder Unterlassen führen, das Gegenstand eines entgeltlichen Vertrags sein kann und das eine Gegenleistung auslöst. Die Leistung muss dabei aber um des Entgelts willen erbracht werden.